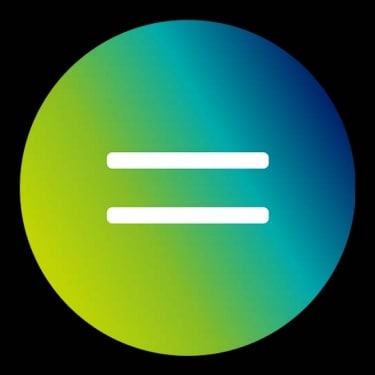Article
„Die Pride-Initiative ist das beste Coming-Out, das man haben kann”
LeaderIn bittet zum Gespräch: In der digitalen Runde sitzen Kathrin Lorenz, Artur Meinzolt, Maike Ehrich und Sophia-Luise Pietsch. Sie alle arbeiten bei Deloitte und engagieren sich – entweder als Community-Mitglieder oder als Ally – in der Pride-Initiative. Welche Erfahrungen haben sie in ihrem Arbeitsleben gemacht und was wünschen sie sich von Kolleg:innen und Führungskräften?
LeaderIn: Habt ihr eine Arbeitspersönlichkeit? Und wenn ja, seht ihr Unterschiede zu eurer privaten Persönlichkeit?
Sophia: Meine Arbeitspersönlichkeit ist eigentlich auch meine private Persönlichkeit. Ich lasse nur ein paar Sachen weg. Das gibt es ja oft, dass in Calls am Anfang kurz zum Beispiel über das Wochenende gesprochen wird: „Ich habe mit meiner Frau das gemacht oder ich war mit den Kindern wandern.“ Da beteilige ich mich einfach nicht dran und das hat bisher auch immer gut funktioniert. Aber wenn dann doch direkte Fragen kommen, bin ich oft einfach Single. Meistens wird automatisch angenommen, dass ich heterosexuell sei. Das sorgt natürlich auch dafür, dass ich auf manchen Ebenen schlechter Kontakte knüpfen kann als andere. Aber der Gedanke daran, dass man den Teil von sich selbst, der die eigene Identität ziemlich stark prägt, versteckt, ist für mich allgegenwärtig.
Kathrin: Je nachdem, wie das Umfeld ist, also beispielsweise welches Alter in der Runde gerade anwesend ist, kann mal ein bisschen offener gesprochen werden. Man distanziert sich aber doch von den Gesprächen, in denen direkt gefragt wird: „Und, schon Kinder?“ Darauf folgt immer nur ein kurzes „Nein“. Oder auch wenn ich erzähle, dass ich im Urlaub war, dann kommt natürlich immer die Frage „Mit deinem Freund?“ Wo ich dann auch immer sagen muss „Nein, mit meiner Freundin.“ Aber selbst, wenn ich es schon mal offen sage, verstehen die Leute nicht immer, dass nicht die „beste Freundin“ gemeint ist.
Artur: Ihr engagiert euch aber beide in der Deloitte-Pride-Initiative und steht auch dafür. Bekommen das die Kolleg:innen nicht mit oder nehmt ihr das billigend in Kauf, dass sie es mitkriegen? Wollt ihr vielleicht gar nicht, dass sie es mitbekommen?
Kathrin: Doch und seitdem bin ich deutlich offener geworden. Wenn jemand ein Problem damit hat, dann ist das seine oder ihre Sache und nicht meine. Ich habe viel Rückhalt erfahren. Es gibt Kolleg:innen, die lassen einen einfach leben und dann gibt es auch diejenigen, die das Thema aktiv unterstützen. Deswegen bin ich auch so dahinter, das weiter voranzubringen und ich stehe auch gern mal dafür ein, wenn kritische oder unangemessene Fragen oder Sätze zurückkommen. Man muss lernen, mit verschiedenen Reaktionen umzugehen und die Leute nicht direkt anzugreifen, sondern zunächst zu verstehen, warum sie anders denken oder eine andere Meinung haben.
Sophia: Ich habe mich auch ganz bewusst dazu entschieden, bei der Pride-Initiative mitzumachen. Mir ist klar, dass ich damit nun exponiert bin. Ich will das sogar, weil das für mich wie ein Paukenschlag ist. Das ist das beste Coming-out, das man haben kann. Natürlich habe ich bereits einigen Kolleg:innen, mit denen ich ein gutes Verhältnis habe, davon erzählt, weil ich es respektvoll finde, ihnen auch von meinem Privatleben zu erzählen. Dennoch ist es für mich definitiv ein Sprung ins kalte Wasser, aber absichtlich.

Rückhalt ist wichtig – auch von ganz oben
Kathrin: Nicht alle in der Pride-Initiative gehören auch der Community an. Es gibt Kolleg:innen wie zum Beispiel Maike, die das Thema wichtig finden und auch tatkräftig unterstützen.
Maike: Was hindert Menschen daran, ihr „whole self“ am Arbeitsplatz zu sein? Was hindert dich daran Sophia? Hast du schlechte Erfahrungen gemacht?
Sophia: Nicht am Arbeitsplatz, aber im familiären Umfeld. Dementsprechend habe ich mich vor ein paar Jahren entschieden, mich dem nicht auszusetzen, weil ich nicht weiß, wie die Leute reagieren. Das ist Selbstschutz.
LeaderIn: Hilft es mit der Community im Rücken, diesen Schritt zu gehen? Ist man offener, wenn man weiß, da sind auch noch andere Kolleg:innen, die sich in einer Community gefunden haben?
Kathrin: Absolut. Wenn man mitbekommt, dass Kolleg:innen auf höchster Ebene die Community unterstützen, dann kommt das auch noch mal ganz anders bei denen an, die vielleicht unüberlegte Witze machen. Ich persönlich wurde noch nie angegriffen. Aber man bekommt das trotzdem am Rande mit und irgendwie ist alles immer „schwul“ oder „tuntig“. Ich sage ja auch nicht „Du bist aber hetero.“
Artur: Es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass Homosexualität und Heterosexualität eher ein Spektrum darstellen, auf dem man sich befindet. Die wenigsten sind an den kompletten Extremen. Meine Theorie für Homophobie ist, dass Menschen mit einer hohen Unsicherheit bezüglich ihrer sexuellen Identität und einem starken Bedürfnis, der Norm zu entsprechen, oft Angst haben, Aggression und Ablehnung zu erfahren. Oft haben diese Menschen mit sich selber sehr viele Probleme. Das hat mir immer ziemlich geholfen, damit klarzukommen. Obwohl ich auch gestehen muss, ich war Homophobie noch nie selbst ausgesetzt, aber ein paar Sachen bekommt man natürlich mit. Wobei ich auch unterscheide, da muss man auch ein bisschen darüberstehen. Ein Schwulenwitz bedeutet nicht gleich, dass derjenige oder diejenige komplett homophob ist, sondern einfach die Sensibilität fehlt.
Sophia: Aber wenn solche Sprüche immer wieder gemacht werden, finde ich schon, dass das dann irgendwann unter der Gürtellinie ist. Die betroffenen Personen denken dann vielleicht, dass ihre Arbeit nicht wertgeschätzt wird. Die machen sich dann auch Gedanken, ob sie überhaupt in der Karriereleiter weiterkommen, weil sie homosexuell sind. Wenn sie sich mit solchen Fragen beschäftigen, weil sie sich irgendwelche Sprüche anhören müssen, dann ist das schade. Auch, wenn die Kolleg:innen ursprünglich vielleicht nichts Böses mit ihren Witzen im Sinn hatten und denken, das sei lustig. Irgendwann ist auch der Witz vorbei.

Wie kann man unterstützen?
LeaderIn: Wie könnte man als Ally in solchen Situationen auftreten?
Artur: Ich glaube, dass grundsätzlich ein bisschen mehr Empathie in solchen Situationen erlernt werden sollte. Gerade als Person, die Verantwortung für ein Team hat, sollte man sich ein paar Sekunden länger überlegen, ob man mit Bemerkungen jemandem das Gefühl gibt, ausgeschlossen zu sein.
Kathrin: Wenn jemand das vermehrt mitbekommt, sollte es angesprochen werden. Ich würde das aber nicht vor der gesamten Gruppe, sondern lieber one on one machen, um die Person nicht bloßzustellen, sonst wird das gleiche Umfeld wie beim initialen Kommentar geschaffen, das wäre kontraproduktiv. Wenn jemand die Person alleine erwischt, kann gesagt werden: „Du, ich glaube, das war gerade ein bisschen daneben, achte doch da das nächste Mal drauf.“
Maike: Oft wird dann in der Gruppe auch anders reagiert, als wenn man die Person einzeln vor sich hat. Unter Männern ist das auch noch mal ein bisschen anders als unter Frauen, könnte ich mir vorstellen.
Artur: Inwiefern?
Maike: Männer müssen sich ja immer ein bisschen auf die Brust klopfen und was erreichen und männlich sein. Schwäche zeigen darf man in Männergruppen oft nicht. Wir Frauen sind da irgendwie offener.
Kathrin: Ich finde auch generell, dass homosexuelle Frauen anders wahrgenommen werden als homosexuelle Männer. Zum Beispiel zwei Frauen, die vielleicht auch lesbisch sind und Händchen haltend durch die Stadt laufen.
Vorbilder sind wichtig – für alle marginalisierten Gruppen
Artur: Das glaube ich auch, mittlerweile gibt es mehr Vorbilder oder Bilder von schwulen Männern als von lesbischen Frauen. Rolemodels sind gerade im Berufsleben ein Thema. Ich hatte ein relativ spätes Coming-out und auch danach habe ich nie viel bei der Arbeit über mein Privatleben gesprochen. Als ich bei einem anderen Unternehmen frisch zum Partner befördert wurde, ist mir die Relevanz von Vorbildern klargeworden. Dabei ging es gar nicht um sexuelle Identität, sondern ein junger türkischer Kollege hat mich angesprochen, dass das ja wahnsinnig toll und wichtig sei, dass ich nun als „Farbklecks“ in der Führungsriege sei. Das Gespräch hat mir gezeigt, dass man da als Führungskraft eine gewisse Verantwortung hat, auch als Vorbild zur Verfügung zu stehen mit all den Facetten oder Identitäten, die man hat. Allerdings hatte ich da diesen Aspekt, den ich ganz interessant fand: Als schwuler Mann ist es sehr einfach, sich im öffentlichen Leben, im Berufsleben zu outen und noch akzeptiert zu werden, wenn man in einer festen Beziehung ist. Ich lebe mit meinem Freund zusammen, der hat auch einen vernünftigen Job und ist auch präsentabel, also wir sind kein Powercouple oder sowas, aber er arbeitet im Bundestag. Ich dachte mir immer, wie ich damit umgehen könnte, wenn ich nicht in einer festen Beziehung wäre. Das wäre wesentlich schwieriger.
LeaderIn: Inwiefern hilft es euch anderen, wenn ihr Rolemodels seht und was können Bestrebungen von Rolemodels sein, um eine Community oder auch individuelle Mitarbeiter:innen zu stärken?
Sophia: Als ich gehört habe, dass die Pride-Initiative gegründet wurde und da schon zwei junge Frauen mitmachen, hat mich das motiviert, mitzumachen. Da habe ich angefangen zu überlegen, wie ich mich engagieren kann. Ich möchte unbedingt auch so mutig sein und andere wissen lassen, um dann wiederum andere anzustecken, die sie selbst sein wollen.
Kathrin: Da kann ich nur zustimmen. Wenn jemand mit gutem Beispiel vorangeht, dann ziehen die Leute mit. Wenn man merkt, du bist nicht alleine und wirst es auch niemals sein. Ob du schwul, lesbisch, bi oder transgender bist. Ob du eine Frau bist oder ein Mann. Ob du aus Spanien kommst, aus Frankreich, aus China. Wenn es Rolemodels gibt, die zeigen, wie man Themen angreifen und voranbringen kann, sind die Leute ganz anders motiviert. Ich bin froh mit unserer Pride-Initiative zu erfahren, dass so viele dahinterstehen und unterstützend mitarbeiten. Das ist ein ganz tolles Gefühl und umso wichtiger sind Rolemodels auch für die Zukunft.
LeaderIn: Was zeichnet eurer Meinung nach ein diverses Arbeitsumfeld noch aus? Wie kann zum Beispiel Leadership dabei unterstützen?
Artur: Mir ist es wichtig, eine normbildende Mehrheitskultur im Unternehmen zu vermeiden. Wenn wir divers sein wollen, geht es um genau diese verschiedenen Hintergründe: Nationalitäten, ethnische Hintergründe, sexuelle Identität. Auch der soziale Hintergrund spielt eine wichtige Rolle. In Beratungsunternehmen kommt die überwiegende Mehrheit aus Akademikerhaushalten. Viele Kolleg:innen, die diesen Hintergrund nicht haben, fühlen sich vielleicht auch nicht wirklich beheimatet, wenn über Golf oder jagen als Hobbys gesprochen wird. Wenn man eine Organisation mit den besten Talenten und kreativ und innovativ sein will, kann man nicht sagen: Wir wollen die besten heterosexuellen weißen Männer, die golfen und jagen gehen. Sondern wir wollen die besten Leute für den Job und das kann alles sein. Dann muss man sich auch anstrengen, allen eine Kultur zu bieten, die eben nicht ausschließt und wo wir uns alle zu Hause fühlen können.

Pride ja – aber bitte glaubwürdig
Maike: Ich finde auch, dass es nicht nur „große“ Rolemodels geben muss. Ich kann auch selbst ein kleines Rolemodel in meinem Umfeld sein, indem ich respektvoll mit meinen Kolleg:innen umgehe. Ich sage das auch im Privaten ganz oft und sehr direkt, wenn jemand eine diskriminierende Bemerkung macht, dass ich das nicht gut finde. Das hat vielleicht auch etwas mit dem Alter zu tun. Ich bin jetzt 42. Mit Mitte 20 war ich noch nicht so weit, wie ich es jetzt bin. Durch gewisse Lebensereignisse konnte ich an mir arbeiten und habe damit auch für mich ein anderes Umfeld geschaffen, reagiere anders in Gesprächen. Im Berufsleben habe ich das Gefühl, direkter sein zu können.
LeaderIn: Viele Unternehmen beteiligen sich nun auch an Pride-Paraden oder am Pride-Month und sind relativ outspoken. Wie findet ihr das, wenn sich Unternehmen da „positionieren“?
Maike: Das ist total wichtig!
Artur: Ich finde es sehr wichtig, dass es glaubwürdig ist. Mittlerweile hat im Pride-Month Juni jeder eine LGBTQ-orientierte Kampagne und bei vielen Unternehmen finde ich es nicht ganz aufrichtig. Man pinselt außen etwas Buntes drauf, um offen zu wirken, hat aber nicht richtig kapiert, worum es geht. Ich finde, man sollte sich intern erst bewusster dahingehend aufstellen und etwas verändern, bevor man mit dem Thema nach draußen geht.
Sophia: Man sieht es auch an der Besetzung der Führungsrollen im Unternehmen. Zehn weiße, über 60 Jahre alte Männer in der Führungsriege – das spricht keinen von der Gen Z an und das sind eben demnächst unsere Arbeitnehmer:innen, unsere neuen Kolleg:innen. Die wollen nicht mehr in solchen Firmen arbeiten.
Kathrin: Ich würde auch behaupten, dass wir mit unserer Community noch am Anfang stehen und uns gerade finden: Was macht Sinn? Wie bekommen wir unsere Kolleg:innen mit ins Boot? Solche Initiativen sollten langlebig, zukunftsfähig und nachhaltig sein. Im besten Fall wird es zu etwas, über das man nicht mehr aktiv nachdenken muss, sondern was gelebt wird – und dann kann es auch authentisch nach außen getragen werden.
Artur: Letztendlich sind wir aber auch hier um einen Job zu machen, gemeinsam erfolgreich zu sein und uns einzubringen. Es ist nicht so, dass ich mich oder jemand von euch sich hauptberuflich als schwul oder lesbisch bezeichnen würde. Genauso wenig wie sich jemand anderes als hauptberuflich hetero bezeichnen würde. Das ist einfach ein Aspekt der Persönlichkeit. Ich fordere auch aktiv ein, dass dieser Aspekt akzeptiert wird und dass ich offen damit umgehen kann. Am Ende des Tages ist unser großes verbindendes Element, gemeinsam für Kunden zu arbeiten, sie zu unterstützen, im Markt erfolgreich zu sein und gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Das ist ein wichtiger Ansatz unserer Kultur und Diversity & Inclusion, das Gemeinsame herauszustellen und alles andere da mitreinlegen zu können.