Article
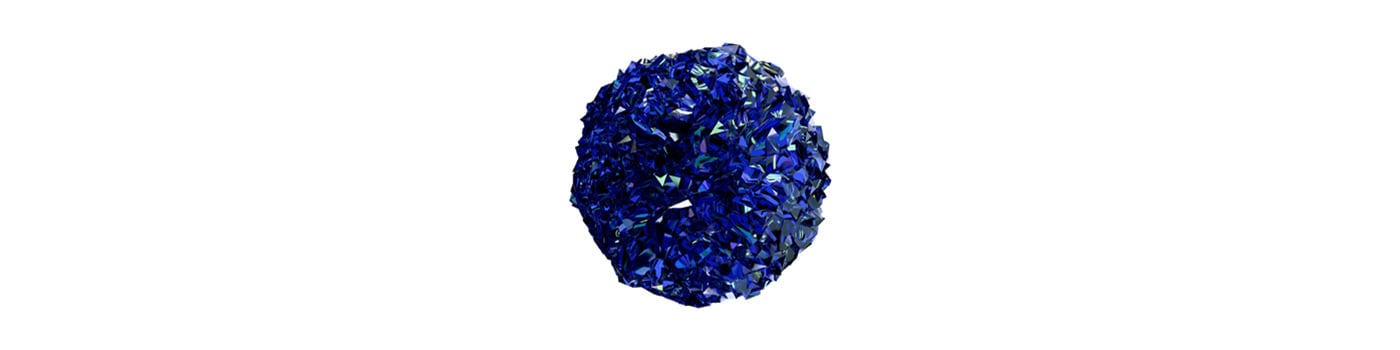
Neues aus Brüssel: weitere Harmonisierung des Insolvenzrechts soll Klarheit und Vereinfachung bei der grenzüberschreitenden Unternehmenssanierung schaffen
Die Mühlen in Brüssel mögen langsam mahlen, aber sie mahlen stetig: kaum haben die Mitgliedsstaaten die Richtlinie (EU) 2019/1023 zur Einführung eines präventiven Restrukturierungsrahmens umgesetzt (in Deutschland durch das Unternehmensstabilisierungs- und restrukturierungsgesetz („StaRUG“), welches am 1. Januar 2021 in Kraft getreten ist), strebt die EU-Kommission eine weitere Harmonisierung der teilweise sehr divergierenden Insolvenzordnungen der Mitgliedsstaaten an. Am 07. Dezember 2022 hat sie dazu einen Richtlinienentwurf veröffentlicht, in welchem die Kommission bestimmte Mindeststandards für die nationalen Insolvenzordnungen der Mitgliedsstaaten definiert, um so eine effiziente Abwicklung von Insolvenzverfahrens zu ermöglichen und gleichermaßen grenzüberschreitende Investitionen zu fördern und die Wettbewerbsbedingungen innerhalb des Europäischen Binnenmarktes anzugleichen.
Bei dem vorliegenden Richtlinienentwurf handelt es sich zunächst nur um einen ersten Diskussionsvorschlag, dessen Inhalt durch die EU-Mitgliedsstaaten weiter zu verhandeln und zu konkretisieren ist, bis am Ende des gesetzgeberischen Prozesses eine EU-Richtlinie vom Europäischen Parlament verabschiedet werden kann. Erst im Anschluss haben die Mitgliedsstaaten die Richtlinie in jeweils nationales Recht umzusetzen. Angesichts der durchschnittlichen Dauer des europäischen Gesetzgebungsverfahrens und der Ungewissheit, welchen Inhalt die finale Fassung der Richtlinie haben wird, ist es nicht verwunderlich, dass sich lediglich 21% der von uns im Rahmen der Restrukturierungsstudie Befragten überhaupt mit dem Entwurf auseinandergesetzt haben. Dem gegenüber steht mit 59% der Befragten eine große Mehrheit, die sich bisher überhaupt nicht oder nur am Rande mit dem Richtlinienentwurf und den Vorschlägen der EU-Kommission befasst haben. Dabei gäbe es ausreichend Veranlassung dazu, sich die Einzelheiten der Harmonisierungsvorschläge anzuschauen und sich beizeiten zu positionieren, ist doch schon jetzt absehbar, dass sich (auch) für das deutsche Insolvenzrecht einige signifikante Änderungen ergeben werden.
Der neue Richtlinienentwurf konzentriert sich auf einzelne Teilbereiche des materiellen Insolvenzrechts, insbesondere das Insolvenzanfechtungsrecht und das sogenannte „Asset Tracing“ sowie die Geschäftsführerhaftung. Zusätzlich enthält der Richtlinienentwurf Vorgaben zur Einführung sogenannter „Pre-Pack“-Verfahren sowie für ein vereinfachtes Verfahren für Kleinstunternehmen. Unberücksichtigt bleiben dagegen andere, durchaus wesentliche Fragestellungen wie z.B. die Definition von Insolvenzgründen oder die Rangfolge der Gläubiger bei der Verteilung der Insolvenzmasse; (gerade) auch dort bestehen erhebliche Unterschiede in den nationalen Insolvenzrechtsordnungen, die eigentlich dem Harmonisierungsgedanken der EU-Kommission diametral gegenüberstehen. Aus Praktikabilitätsgründen hat sich die Kommission aber für eine Mindestharmonisierung (auch Harmonisierung der kleinen Schritte) entschieden, um angesichts der doch starken Divergenzen überhaupt Fortschritte erzielen zu können.
Soweit ersichtlich stehen im Mittelpunkt der kontrovers geführten Diskussion in den Mitgliedsstaaten hauptsächlich das vorgenannte „Pre-Pack“-Verfahren („Pre-Pack“) sowie das vereinfachte Verfahren für Kleinstunternehmen, welches in der Regel ohne die Bestellung eines Insolvenzverwalters auskommen soll. Hier stehen sich die divergierenden Interessen der einzelnen Stakeholder eines Insolvenzverfahrens am offensichtlichsten gegenüber. Wohl aufgrund der Besonderheiten des deutschen Insolvenzrechts, das in der gegenwärtigen Form bereits eine Art von Pre-Pack kennt (nämlich während des vorläufigen Verfahrens), sprechen sich lediglich 26% der von uns Befragten gegen die Einführung eines gesonderten Pre-Pack-Verfahrens aus. Klarer ist hingegen die Bewertung des Vorschlags zur Einführung eines (verwalterlosen) Verfahrens für Kleinstunternehmen, dem eine klare Mehrheit von 56% der Befragten ablehnend gegenübersteht (und nur von insgesamt 23% der im Rahmen unserer Studie Befragten als positiv eingeschätzt wird).
Pre-Pack-Verfahren
Das Pre-Pack-Verfahren bezeichnet eine Vorgehensweise im Insolvenzrecht, bei der vor der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ein Verkauf von Vermögenswerten des insolventen Unternehmens oder sogar einer ganzen Gruppe unter Zustimmung der Gläubiger und des Gerichts organisiert wird. Ziel ist es, den Unternehmenswert zu erhalten, Arbeitsplätze zu sichern und eine zügige Abwicklung des Insolvenzverfahrens zu ermöglichen. In einigen Europäischen Rechtsordnungen ist das Pre-Pack lange etabliert und akzeptiert. Es bietet dort den Vorteil einer raschen Lösung, die oft weniger disruptive Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb und die Beschäftigung hat und dementsprechend bessere Ergebnisse für die Gläubiger erzielt.
Der Richtlinienentwurf sieht für das Pre-Pack eine sogenannte Vorbereitungs- und anschließende Liquidationsphase vor. Während der Vorbereitungsphase wird der Verkauf der Vermögensgegenstände (bzw. des operativen Betriebs) des Insolvenzschuldners vorbereitet, d.h. ein M&A-Prozess in Gang gesetzt, mit Investoren gesprochen und schließlich ein Kaufvertrag verhandelt. In dieser Phase soll nach dem Richtlinienentwurf der Schuldner weiterhin die Verfügungsgewalt über seine Vermögenswerte und die Geschäftsführungsbefugnis behalten. Dafür wird ihm ein sogenannter „Monitor“ an die Seite gestellt. In der deutschen Fassung wird dieser „Monitor“ als „Sachwalter“ bezeichnet, der aber nicht mit dem Sachwalter einer (sonstigen) Eigenverwaltung identisch ist. Der „Monitor“ muss die gleichen fachlichen Eignungen mitbringen wie ein Insolvenzverwalter und soll den Verkaufsprozess im Wesentlichen begleiten. Hierfür muss er den Prozess dokumentieren, den Markt- sowie Wettbewerbsstandards kontrollieren, das beste Gebot auswählen und schließlich bestätigen, dass dessen Annahme im besten Gläubigerinteresse ist, insbesondere keinen schlechteren Wert erzielt als bei einer sogenannten Einzelliquidation.
Erst mit der eigentlichen Eröffnung des Insolvenzverfahrens (d.h. mit der Liquidationsphase) wird die Veräußerung des Schuldnerunternehmens vollzogen, d.h. der vorher ausgehandelte Kaufvertrag von den Parteien unterzeichnet und durch das zuständige Gericht genehmigt. Grundsätzlich erwirbt der Käufer das Unternehmen, beziehungsweise die wesentlichen Unternehmensbestandteile, schuldenfrei.
Von Kritikern wir oftmals bemängelt, dass ein Pre-Pack nicht den Ansprüchen an die erforderliche Transparenz gerecht werde, was die Gefahr des Missbrauchs mit sich bringe. Das Verfahren könne insbesondere genutzt werden, um bestimmten Gläubigern Vorteile zu verschaffen oder um unerwünschte Verträge loszuwerden. Der schnelle Verkaufsprozess unter Leitung der Geschäftsführung des Schuldnerunternehmens könnte dazu führen, dass Vermögenswerte unter ihrem tatsächlichen Wert verkauft und Minderheitsgläubiger benachteiligt werden.
Für die Einführung des Pre-Pack in Deutschland ist dabei zu berücksichtigen, dass das deutsche Insolvenzrecht bereits ein zweistufiges Verfahren vorsieht und vor die Eröffnung des Insolvenzverfahrens das sogenannte vorläufige Insolvenzverfahren gesetzt hat. Diese Zweistufigkeit existiert in vielen anderen Staaten gerade nicht; vielmehr erfolgt dort die Verfahrenseröffnung mit bzw. unmittelbar nach Antragstellung, sodass der Vorschlag zur Einführung einer besonderen gesetzlichen Grundlage für die vor Verfahrenseröffnung stattfindenden Verhandlungen nachvollziehbar und sinnvoll ist.
Im Unterschied dazu werden in einem deutschen Insolvenzverfahren die im Richtlinienentwurf vorgesehenen Vorbereitungshandlungen regelmäßig im vorläufigen Insolvenzverfahren umgesetzt; dies gilt insbesondere für die Einleitung eines M&A-Verfahrens und die damit einhergehende Ansprache von möglichen Investoren und schließlich die Verkaufsverhandlungen. Legt man dieses Verständnis zugrunde, bestünde der Unterschied zwischen Insolvenzordnung und Richtlinienentwurf der Kommission lediglich darin, dass letzterer für das Pre-Pack immer von einer Eigenverwaltung ausgeht, was nach dem deutschen Insolvenzrecht nicht zwangsläufig der Fall sein muss. Der Richtlinienentwurf bedarf so gesehen der Klarstellung, dass ein vorläufiges Insolvenzverfahren nach deutscher Spielart als Pre-Pack im Sinne der Richtlinie gilt. Um zusätzlich die oben genannten Kritikpunkte zu adressieren, könnten in Deutschland ggf. zusätzliche Regelungen eingeführt werden, die für mehr Transparenz, Gleichbehandlung der Gläubiger und einen fairen Verkaufsprozess sorgen.
Regelungen für Kleinstunternehmen
Für erhebliche Unruhe hat außerdem der Vorschlag zur Einführung eines Verfahrens für Kleinstunternehmen gesorgt. Dieses soll sich vor allem dadurch auszeichnen, dass es schnell und kostengünstig, grundsätzlich in Eigenverwaltung und ohne Insolvenzverwalter durchgeführt wird und auch trotz Fehlens einer verfahrenskostendeckenden Vermögensmasse eröffnet werden kann. Als Kleinstunternehmen („Microenterprise“) sollen nach dem Richtlinienentwurf Unternehmen gelten, die weniger als 10 Mitarbeiter beschäftigen bei jährlichen Umsätzen von nicht mehr als € 2 Mio. oder einer Bilanzsumme von nicht mehr als € 2 Mio. Für solche Unternehmen soll künftig bei Zahlungsunfähigkeit (nicht aber bei Überschuldung) ein vereinfachtes Liquidationsverfahren auf Kosten des Fiskus und vornehmlich standardisiert auf elektronischem Wege möglich sein. Die Bestellung eines Insolvenzverwalters soll in diesen Fällen nur erfolgen, wenn Schuldner, Gläubiger oder eine Gläubigergruppe dies beantragen und die Kosten aus der vorhandenen Masse gedeckt werden können bzw. vom Antragsteller vorgeschossen werden.
Insbesondere die Interessenverbände der Insolvenzverwalter, aber auch der Kreditindustrie und/oder Warenkreditversicherer sprechen sich deutliche gegen die Einführung eines solchen Verfahrens aus und verweisen u.a. auf die – aus ihrer Sicht auf der Hand liegenden – Risiken des Missbrauchs.
Dabei liegt dem Vorschlag der Kommission zunächst der Gedanke zugrunde, dass viele Kleinstunternehmen (inklusive Einzelunternehmer) unter den bestehenden Gegebenheiten benachteiligt sind, weil die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen regelmäßig mangels ausreichender Masse abgelehnt wird und sie daher keine Möglichkeit haben, nach Restschuldbefreiung einen zweiten Anlauf starten zu können. Der Gedanke ist dabei nicht neu: um den besonderen Herausforderungen und Bedürfnissen solcher Unternehmen Rechnung zu tragen, hat die United Nations Commission on International Trade Law („UNCITRAL“) schon von einigen Jahren ein (weiteres) Modellgesetz für Insolvenzverfahren von Kleinstunternehmen veröffentlicht, dessen Regelungen ebenfalls darauf abzielen, die Verfahren für Kleinstunternehmen in der Insolvenz zu vereinfachen, die Kosten zu senken und die Dauer des Verfahrens zu verkürzen.
Das geltende deutschen Insolvenzrecht wird diesen besonderen Herausforderungen nicht ausreichend gerecht. Eine masselose Schuldnergesellschaft wird zwar auch nach Ablehnung der Verfahrenseröffnung im Handelsregister gelöscht, ohne dass das Registergericht die gesellschaftsrechtliche Liquidation beaufsichtigen würde; jedoch bleibt dem Unternehmer bei eigener Zahlungsunfähigkeit (die regelmäßig wegen abgegebener Bürgschaft oder Schuldbeitritt vorliegen wird) nur die Entschuldung im Wege der Privatinsolvenz, welche wiederum die unternehmerischen Risiken nicht von privaten Konsumrisiken trennt. Selbst dem redlichsten Unternehmer steht dann nur alle 16 Jahre eine Entschuldung zu. Für mithaftende Angehörige gilt dies entsprechend (die Sittenwidrigkeitsrechtsprechung des BGH zu Bürgschaften und Schuldbeitritten hilft wegen der an sie gestellten hohen Anforderungen nur im absoluten Ausnahmenfall). Der Richtlinienvorschlag kann hier zumindest teilweise Abhilfe schaffen.
Zur Vorbeugung gegen Missbrauch könnte man neue Wege beschreiten und diese Verfahren in die Obhut besonderer Behörden z.B. nach dem Vorbild des Schweizer Konkursamtes oder des Insolvency Services in Großbritannien bzw. Irland legen. Bei einer gleichzeitigen hochgradigen Digitalisierung der Verfahrensabläufe könnte dies zu einer deutlichen Effizienzsteigerung und damit zur Minimierung von Kosten führen. Einzig über die Schwelle der Zugangsvoraussetzung müsste bewusst diskutiert werden, damit tatsächlich nur sehr kleine Unternehmen, die keine volkswirtschaftliche Relevanz haben, an dieser Erleichterung partizipieren können.
„Mit ihrem Richtlinienentwurf ebnet die EU-Kommission erstmals der Harmonisierung des materiellen Insolvenzrechts in der Europäischen Union den Weg. Ziel ist es, europaweit einheitliche Regelungen im Insolvenz- und Restrukturierungsrecht einzuführen. Neben dem Abbau von Investitionshemmnissen soll die Einführung von Mindeststandards den Gläubigern die größtmögliche Werterholung ermöglichen, für eine effiziente Abwicklung sorgen und auch im Übrigen ganz allgemein die Interessen der Gläubiger wahren.“
Frank Tschentscher
Fazit
Es bleibt abzuwarten, in welcher Form und in welchem Umfang der Richtlinienentwurf aus den nun folgenden Beratungen der EU-Mitgliedsstaaten hervorgehen wird. Jedenfalls erscheint die weitere Harmonisierung des Insolvenzrechts im Grundsatz begrüßenswert, um insbesondere bei grenzüberschreitenden Sachverhalten die Möglichkeiten einer erfolgreichen Restrukturierung zu gewährleisten. Mit Blick auf die derzeitig geführten Diskussionen darf man mit einigen Änderungen und Anpassungen im Laufe des Gesetzgebungsprozesses rechnen. Sodann stellt sich die Frage, wie der deutsche Gesetzgeber die teilweise gegebenen Gestaltungsspielräume bei der Umsetzung der späteren Richtlinie nutzen wird. Selbst wenn man aber davon ausgehen wollte, dass die Richtlinie mit dem derzeitigen Wortlaut verabschiedet wird, so sind die für Deutschland zu erwarteten Änderungen wie zuvor dargestellt eher gering und/oder bei Anwendung der gebotenen objektiven Betrachtung zu vernachlässigen.
Auch interessant
Rechtlicher Rahmen als Chance in der Krise
Früherkennungssysteme zur Vermeidung unternehmerischer Krisen und Haftungsrisiken


